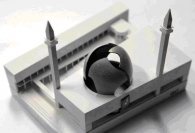 Moscheenbau 17.06.2007 12:18
Moscheenbau 17.06.2007 12:18
politonline d.a. Was den Moscheenbau betrifft, so seien am besten die Worte des Innenministers der BRD, Wolfgang Schäuble, vorangestellt: Der Bau von Moscheen ist seiner Ansicht nach keine Bedrohung, sondern eine »Bereicherung«. Die Politik sollte »immer dafür werben, dass wir Kirchen, Synagogen und Moscheen nicht als Bedrohung, sondern als Bereicherung empfinden«, so Schäuble. Es ist nirgendwo festgehalten, dass er diese Auffassung je seinem türkischen Kollegen näher gebracht hätte, geschweige denn, dass etwas darauf hindeutete, dass er sich mit den für Christen in der Türkei und in einigen anderen islamischen Ländern herrschenden desolaten Verhältnissen vertraut gemacht hätte. Aber wir sind es ja gewohnt, dass unsere Volksvertreter einen Hang dazu haben, uns in Sachen Toleranz und Bereitwilligkeit zu überfordern, selbstverständlich ohne Gegenleistungen zu verlangen. Bei über drei Millionen Muslimen in Deutschland, so Schäuble ferner, sei der Islam ein »Teil des deutschen Landes« geworden. Das merkt die Bevölkerung inzwischen ganz gewaltig. Würde diese Bereicherung der Wirklichkeit standhalten, so wäre man noch geneigt, seine Sicht der Dinge in Betracht zu ziehen. Bei einer genauen Sondierung der Lage ist jedoch schon lange nicht mehr zu verkennen, dass der Islam in Tat und Wahrheit massive Probleme für die Bevölkerung geschaffen hat, die vor allem der Autor Udo Ulfkotte eindringlich festgehalten hat.
Angesichts der zahlreichen Schwierigkeiten, mit denen die Bevölkerung allein fertigwerden muss - und die Herrn Schäuble in seinem wohlabgesicherten Dasein natürlich nicht treffen - ist eher damit zu rechnen, dass die »hehren« Worte des Innenministers von denjenigen, die in den Grosstädten unter den durch den Islam hervorgerufenen Zuständen leiden, als regelrechter Affront empfunden wird. Damit nicht genug. Es wird ersichtlich, dass mit dieser speziellen Bereicherung auch eine ganz spezielle Toleranz einhergeht, die offensichtlich verlangt, dass das eigene Kulturgut übergangen wird. Dies belegt das folgende Beispiel.
Die 7. Klassen der Maria-Ward Mädchenrealschule Sparz in Traunstein führten eine Fahrt nach München zur dortigen Moschee in Pasing und zur neuen Synagoge am Jakobsplatz durch. In dem von den Lehrern des Fachbereichs Katholische und Evangelische Religionslehre an die Eltern gerichteten Schreiben hiess es: »Der Besuch dieser Gotteshäuser dient der Unterrichtsergänzung in den Fächern kath. und evang. Religionslehre und Erdkunde, aber auch der allgemeinen Wissenserweiterung und Erziehung zur Toleranz gegenüber anderen Religionen und Kulturen.« Die Münchner Frauenkirche oder die einzigartig schön renovierte Theatinerkirche, das eigentliche Kulturgut der Kinder, stand nicht auf dem Programm. Dasselbe ergab sich für den Ausflug von 12jährigen von Traunstein nach Salzburg, mit dem Ziel, die dortige Synagoge zu besuchen. Den Salzburger Dom durften die Kinder nicht besichtigen. Gleichzeitig wurde darauf hingewiesen, dass für diesen Besuch auf ordentliche, der Würde des Ortes angemessene Kleidung zu achten sei. Nun stelle man dieser Anforderung den Firmunterricht für die Kinder derselben Schule gegenüber: Diese konnten die Kirche in beliebiger Kleidung betreten, egal wie luftig - bauchfrei, Nabel gepierct etc.; sie durften sich im gesamten Kirchenraum mit ihren Malstiften und Zeichenblöcken verteilen und das Ganze wurde mit lauter Technomusik untermalt, was in krassem Gegensatz zu den für die Synagoge und die Moschee angemahnten Bedingungen steht. Im übrigen war in den vorausgegangenen 6 Monaten im katholischen und evangelischen Religionsunterricht ausschliesslich das Thema »jüdische Religion und jüdische Kultur« behandelt worden. Das gelernte Wissen wurde in mehreren Klassenarbeiten abgefragt und benotet, so auch das Ergebnis des Ausflugs nach München. Wer also an demselben aus welchem Grund auch immer nicht teilgenommen hatte, der hatte schlechte Karten. Wie aus Kreisen der betroffenen Eltern zu erfahren war, stellte das Ganze keineswegs eine Extravaganz von Seiten der Lehrerschaft dar: derartige »Informationsausflüge« werden vom bayerischen Kultusministerium zwingend vorgeschrieben - um die Kinder zu mehr Toleranz zu erziehen. Es dürfte kaum jemand an der Erkenntnis vorbeikommen, dass eine derartige Direktive ein regelrechtes Verleugnen des eigenen Kulturguts einschliesst, als etwas anderes lässt sich dies schwerlich interpretieren. Erschreckend ist, dass sich die Religionslehrer mit derartigen Weisungen ganz offensichtlich abfinden.
Wer sollte sich da noch wundern, dass die sich gegen den in Köln-Ehrenfeld geplanten Bau eines islamischen Gotteshauses wehrenden 800 Bürger als rechtspopulistisch gebrandmarkt werden. Und wer wäre unter diesen Umständen noch überrascht, dass CDU, SPD, FDP und Grüne im Kölner Stadtrat das Bauvorhaben unterstützen, ebenso die beiden grossen christlichen Kirchen in Köln. Lediglich die CDU im Stadtteil Ehrenfeld spricht sich dagegen aus. Gegen den Bau wendet sich auch der Schriftsteller Ralph Giordano. Er geht davon aus, dass die Pläne von der Mehrheit der Bürger abgelehnt werden, dass die meisten es jedoch nicht wagten, etwas dagegen zu sagen, aus Furcht, in die »rechtsextreme Ecke« gestellt zu werden. Der geplante repräsentative Kuppelbau für 2000 Gläubige mit den beiden 55 Meter hohen Minaretten wird für das »urkölsche Veedel« als zu dominant betrachtet. Giordano hat sich u.a. wie folgt geäussert: »Wo sind wir denn, dass wir uns überlegen müssten, ob unser Tun und Handeln radikalen Muslimen gefällt oder nicht. (...) Ich bin der Traditionen, Sitten und Gebräuche überdrüssig, die jede Kritik in Beleidigungen umfälschen, selbst aber verschwenderisch mit Verbalinjurien gegen Andersgläubige zur Hand sind.« Er werde sich auch weiterhin tabulos »gegen alle grundgesetzwidrigen und damit integrationsfeindlichen Verhältnisse und Zustände innerhalb der muslimischen Minderheit, allen voran gegen die inakzeptable Stellung der Frau« wenden. In diesem Zusammenhang gibt der nachfolgende, sachlich gehaltene Artikel, der in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erschien, ein gutes Bild der tatsächlichen Gegebenheiten:
Kölner Moscheenstreit - Das Minarett ist ein Herrschaftssymbol Von Necla Kelek
Ralph Giordano hat einen Fehler gemacht. Er hat sich beklagt, dass Islamorganisationen in Köln eine Großmoschee bauen wollen, obwohl es seiner Meinung nach ein falsches Zeichen für die Integration ist. Und er hat sich darüber mokiert, dass in Köln Frauen im Tschador herumlaufen. Prompt wurde er bedroht und beschimpft, weil er religiöse Gefühle beleidigt habe. Sein Fehler war, dass er es gewagt hat, die religiösen Motive der Moscheebauer in Zweifel zu ziehen. Dafür glaubt man, ihn abstrafen zu dürfen. Aber Ralph Giordano hat recht. Der Islam ist und macht Politik. Die Kopftücher, die die Gesichter der Frauen einschnüren, und die farblosen Mäntel, die die Körper der Frauen verbergen sollen, sind das modisch Unvorteilhafteste, was Schneider je zusammengenäht haben, nur noch vom schwarzen Zelt übertroffen, dem Tschador: Er macht die Frauen zu einem entpersönlichten Nichts. Als Muslimin verwahre ich mich dagegen, dass diese Frauen solch eine Verkleidung im Namen des Islams tragen. Es gibt dafür keine religiösen, sondern nur politische Begründungen.
Ein sozialer, kein sakraler Ort
Wenn man in Ankara die größte Moschee, die Kocatepe Camii besichtigen will, steht man zunächst vor einem Einkaufszentrum. Man geht durch die Hosen- und Hemdenabteilung des Kaufhauses, bevor man den Aufgang zur Moschee findet. Die riesige Moschee ruht in ihrer ganzen Breite auf einem Geschäft. Das hat Tradition im Islam, war der Prophet doch selbst Kaufmann; auch beruhen viele Praktiken dieses Glaubens auf einem Handel mit Gott. Moscheen, masjids, sind Orte, an denen man sich niederwirft, und sie sind in der islamischen Tradition keine heiligen Stätten, sondern Plätze, an denen sich die Männer der Gemeinde zum Gebet und Geschäft versammeln. Die Moschee ist in der islamischen Tradition ein sozialer und kein sakraler Ort. Mohammed traf sich dort mit seinen Getreuen. Der Koran erwähnt Moscheen nur in einem Vers: ». . . in Häusern, hinsichtlich derer Gott die Erlaubnis gegeben hat, dass man sie errichtet und dass sein Name darin erwähnt wird . . . « (Koran Sure 24, Vers 36). Moscheen erfüllten, wie der Islamwissenschaftler Peter Heine in seinem Islam-Lexikon schreibt, administrative Funktionen: »Hier fanden die Sitzungen des Stammesrates statt, und sie waren Versammlungsorte, wenn sich die Männer zu einem Kriegszug aufmachten. « Im Laufe der Geschichte haben sich zwei Arten von Gebetshäusern herausgebildet. Einmal als Gebetsraum für das tägliche Gebet der Gläubigen, und zum anderen die »Freitagsmoschee«, in der am Freitag gebetet und die Predigt gehalten wird. Freitagsmoscheen hatten seit jeher einen politischen Charakter, dort verkündete der Kalif seine Doktrin. Die Kölner Moschee ist von Größe und Ausstattung her kein Gebetshaus, sondern eine »Freitagsmoschee«.
Sie verstecken sich in Kulturvereinen
Es ist im Prinzip nichts dagegen zu sagen, dass in Deutschland solche Gebäude errichtet werden. Es gibt die Religions- und Versammlungsfreiheit. Aber die islamischen Vereine sind keine anerkannten Religionsgemeinschaften. Sie könnten diesen Antrag jederzeit in den Bundesländern stellen. So wie es die Aleviten - eine Glaubensrichtung, die von anderen Islamvereinen nicht als muslimisch anerkannt wird - erfolgreich getan haben. Dachverbände wie »Milli Görus« und die von der Türkei gesteuerte »Ditib« (Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion) haben das versäumt. Sie bauen erst ihre Moscheen und setzen auf eine politische Anerkennung auf Bundesebene, etwa als Ergebnis der Islamkonferenz. Bis dahin verstecken sie sich in Kulturvereinen und hinter anderen rechtlichen Hilfskonstruktionen. Das erspart kritische Fragen nach Mitgliedern, Finanzierung und dem Einfluss fremder Regierungen auf ihre Statuten. Moscheen sind selbst nach muslimischer Lesart keine Sakralbauten wie Kirchen oder Synagogen, sondern »Multifunktionshäuser«. Das wird gern verschwiegen. So wie der Islam eben keine Kirche ist. Der Islam begreift sich nicht nur als spirituelle Weltsicht, sondern als Weltanschauung, die das alltägliche Leben, die Politik und den Glauben als eine untrennbare Einheit sieht. Eine verbindliche theologische Lehre gibt es nicht.
Keimzellen einer Gegengesellschaft
In diesem Sinne haben viele Islamvereine in Deutschland die Funktion einer Glaubenspartei, einer politischen Interessenvertretung. Deshalb ist die Frage des Moscheebaus auch keine Frage der Glaubensfreiheit, sondern eine politische Frage. Bau- und Vereinsrecht sind da überfordert. Ein Kriterium für die Erteilung der Baugenehmigung für ein Gebäude eines politischen Islamvereins müsste deshalb die positive Beantwortung der Frage sein: Werden dort die Gesetze eingehalten? Wird zum Beispiel dafür gesorgt, dass Frauen nicht diskriminiert werden? Und eine zweite Frage darf und muss gestellt werden: Dienen sie der Integration? Hier sind Zweifel angebracht. So, wie in vielen Moscheen in Deutschland der Islam praktiziert wird, erweist er sich als ein Hindernis für die Integration. Diese Moscheen sind Keimzellen einer Gegengesellschaft. Vor allem die größeren Moscheen in Deutschland entwickeln sich zu »Medinas«. Dort praktizieren die Muslime, was sie das Gesetz Gottes nennen. Dort wird eben nicht nur die Spiritualität gepflegt und sich um das Seelenheil der Gläubigen gesorgt, sondern dort wird das Weltbild einer anderen Gesellschaft gelehrt und ein Leben im Sinne der Scharia praktiziert. Dort üben schon Kinder die Abgrenzung von der deutschen Gesellschaft, dort lernen sie die Gesellschaft in Gläubige und Ungläubige zu unterscheiden, dass Frauen den Männern zu dienen haben, dass Deutsche unrein sind, weil sie Schweinefleisch essen und nicht beschnitten sind. Diese Moscheen entwickeln sich zu Zentren, in denen wie in einer kleinen Stadt alle Bedürfnisse abgedeckt werden. So finden sich meist in unmittelbarer Nähe, oft in örtlicher Einheit, die Koranschule, koschere Lebensmittelläden, Reisebüros, der Friseur, das Beerdigungsinstitut, Restaurants, Teestuben und anderes mehr - eben alles, was ein Muslim außerhalb seiner Wohnung braucht, wenn er nicht nur beten, sondern auch nichts mit der deutschen Gesellschaft zu tun haben will.
Das kann kein Integrationsmodell sein
Frauen werden - es soll eine Ausnahme geben - nur in separaten Räumen geduldet. Eine Demokratie, vor allem unsere Gesellschaft lebt aber davon, dass Männer und Frauen gemeinsam in der Öffentlichkeit Verantwortung tragen, sie haben gleiche Rechte, und sie müssen gleich behandelt werden. Die Trennung der muslimischen Gemeinde in die der Männer, die in der Moschee sitzen, beten und ihre Geschäfte machen, und die der Frauen, die in ihre Wohnungen verbannt sind, kann kein Integrationsmodell sein. Wenn über Moscheebau diskutiert wird, muss darum die Frage gestellt werden, welche Möglichkeiten der gleichberechtigten Teilhabe die Frauen haben. Solange aber Moscheen archaische und patriarchalische Strukturen fördern, sind solche Häuser für mich nicht akzeptabel. Und ich verstehe auch die Repräsentanten und Vertreter der meisten Parteien nicht, die Toleranz für die Muslime einfordern und gleichzeitig zulassen, dass Frauen auf diese Art diskriminiert werden. Muslime beklagen oft, dass sie ihre Gebetsräume in Wohnungen oder stillgelegten Fabriketagen einrichten mussten. Dabei ist dies durchaus nicht unmuslimisch oder diskriminierend. Die Ur-Moschee war Mohammeds Wohnhaus in Medina: ein Hof mit offener Säulenhalle. Erst als der Islam christliche Kirchen eroberte, änderte sich auch die Architektur der Moscheen. Die Kuppel, wie sie jetzt auch den Kölner Entwurf ziert, verdankt ihre Idee dem Rundzelt, aber ihre Durchsetzung der Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen. Durch Umwidmung des Kuppelbaus der byzantinischen Hagia Sophia zur Moschee wurde eine christliche Kirche zum Vorbild für die türkische Moschee. Minarett und Kuppel wurden Zeichen osmanischer Herrschaft - auch in Mekka.
Ein politisches Statement des Islam in Beton
Der Entwurf für die Kölner Moschee nimmt diese Tradition des Gestus der Eroberung auf. Eine offene Kuppel mit stilisierter Weltkugel zeigt noch keine Weltoffenheit. Es ist entscheidend, was darunter passiert. Man könnte diese Kuppel und das Minarett auch als Hegemonieanspruch deuten, ganz so wie der Islam sich als »Siegel«, als Vollendung der Religionen begreift und den Anspruch auf Weltherrschaft reklamiert. Jedenfalls steht auch dieser Entwurf in osmanischer Tradition und zielt weder von der äußeren Form, noch von der inneren Funktion her auf Erneuerung oder Integration. Die Architekten haben geliefert, was ihre konservativen Auftraggeber wollten: ein politisches Statement des Islams in Beton. Damit steht der Streit um den Bau der Kölner Moschee in einer Linie mit dem Streit um das Kopftuch. Freitagsmoscheen im Stadtbild sind wie die Kopftücher auf der Straße ein sichtbares politisches Statement. Es soll sagen: Wir sind hier, wird sind anders, und wir haben das Recht dazu. Das haben sie tatsächlich. Nur müssen sie sich dann auch gefallen lassen, dass gefragt wird, was sie mit diesem Recht anfangen und für diese Gesellschaft tun. Oder geht es nur um Abgrenzung? Die islamischen Organisationen drängen auf öffentliche Anerkennung. Sie wollen mit den christlichen Kirchen gleichgestellt werden. Wie kann man diesen Anspruch besser deutlich machen als mit Steinen, die sagen: Seht her, wir haben auch solche Gebäude wie Christen und Juden? Dass sich gegen eine solche Politik Widerstand erhebt, ist verständlich. Denn die Muslime in Deutschland haben ein großes Problem: das der Glaubwürdigkeit. Wort und Tat liegen zu oft und zu weit auseinander. Öffentlich gibt man sich verfassungstreu, doch was in den Gemeinden gedacht und gemacht wird, das wird verschleiert, dort gibt es keine wirkliche Transparenz.
Anderswo wären muslimische Spenden besser aufgehoben
Mich beschämt, wie sich viele Vertreter der Muslime in Deutschland präsentieren. Es gibt eine Reihe großer sozialer Probleme: mit der deutschen Sprache, in den Familien, mit der Erziehung, in Fragen der Gleichberechtigung. Es gibt das Problem der Jungenkriminalität, der Gewalt in der Familie und mit der Integration. Das sind drängende Fragen, deren Lösung das Engagement und die millionenteuren Spenden der Muslime eher bräuchten als die Demonstration von Stärke durch Repräsentativbauten. Doch immer, wenn diese sozialen Probleme angesprochen werden, wird sofort behauptet, das habe nichts mit dem Islam zu tun. Doch eine Religion, die den Anspruch erhebt, alle Aspekte des öffentlichen und privaten Lebens eines Gläubigen in Vorschriften und Gebote zu fassen - und dies über vierundzwanzig Stunden eines jeden Tages - kann sich nicht bei erstbester Gelegenheit vor den Folgen dieses Anspruches drücken. Wo ist die Spendenkampagne islamischer Organisationen, die es allen Muslimen ermöglicht, Deutsch zu lernen? Wo sind die Initiativen für frühkindliche Bildung, wo die Aktion für die Gleichberechtigung der Frau? Fehlanzeige. Man hat Geld für Architekten und Anwälte und Beton, man gründet Koordinierungsräte und fordert Anerkennung, ohne auch nur einen Gedanken darauf zu verschwenden, was Muslime für diese Gesellschaft tun könnten und was sie ihr verdanken. Religionsfreiheit zum Beispiel, die den Christen, Aleviten, Aramäern in der Türkei und anderen islamischen Ländern verwehrt wird.
Muslime müssen sich Fragen gefallen lassen
Die Zahl der Sekten und konkurrierender Glaubensrichtungen des Islams ist kaum zu überschauen, doch wird vorgegeben, man trete gemeinsam auf und es wird die taqiyya, die Kunst der Verstellung und des Verschweigens der wahren Haltung gegenüber »Ungläubigen« praktiziert. Die Initiatoren der Kölner Moschee sind Vertreter der türkischen Religionsbehörde Diyanet. Was die Ditib in Deutschland vorführt, ist Politik im Auftrag der türkischen Regierung, nicht aber im Interesse der Muslime, die mehrheitlich zu vertreten sie jedoch vorgibt. Die Organisationen sollten sich deshalb nicht wundern, wenn die Sorge und das Misstrauen wachsen, zumal sie auf Kritik immer wieder beleidigt reagieren. Für unsere westliche Gesellschaft gilt der Satz von Max Frisch: »Demokratie bedeutet, sich in die eigenen Angelegenheiten einzumischen. « Der Islam ist eine Realität in Deutschland. Und er ist deshalb eine Angelegenheit der ganzen deutschen Gesellschaft. Muslime müssen es sich gefallen lassen, wenn andere sie fragen, wie sie leben wollen und wie sie es mit den Grundwerten dieser Gesellschaft halten. So wie es Ralph Giordano in Köln getan hat.
Quelle: F.A.Z., 05.06.2007, Nr. 128 / Seite 33
Udo Ulfkotte: Der Krieg in unseren Städten. Wie radikale Islamisten Deutschland unterwandern. Eichborn-Verlag; ISBN-10: 3821839783
|


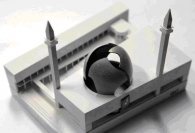 Moscheenbau 17.06.2007 12:18
Moscheenbau 17.06.2007 12:18
