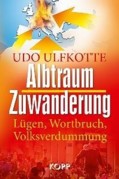Feindbild Russland 10.07.2016 23:49
Feindbild Russland 10.07.2016 23:49
d.a. Im Januar dieses Jahres hielt Prof. Dr. Albert A. Stahel vom Institut
für
Strategische Studien in Wädenswil fest, dass der Präsident der Russischen
Föderation, Wladimir Putin, am 31. Dezember 2015 die neue nationale Sicherheitsstrategie
und -konzeption in Kraft gesetzt hat. »Dank der Einheit in der russischen
Gesellschaft, der sozialen Stabilität, dem Zusammenwirken zwischen allen
Ethnien und der religiösen Toleranz in Russland können die verschiedenen
Bedrohungen abgewehrt werden.« Ferner heisst es: »Durch die Bestimmung eines
umfassenden Sicherheitsbegriffes und der Gegenüberstellung mit dem gesamten
Spektrum der Bedrohung werden die strategischen Massnahmen und Handlungen für
das Erreichen der Sicherheit, so für den Bereich der Verteidigung und der
Streitkräfte, erstellt. Diese neue
Sicherheitskonzeption der Russischen Föderation stellt eine wirkliche
Herausforderung für die USA, ihr NATO-Bündnis und die EU dar.
Die Sicherheit Russlands wird
durch die NATO bedroht -
denn das Bündnis verlegt seine militärische
Infrastruktur zunehmend in die Nähe der russischen Grenzen. Eine weitere
Herausforderung für Russland stellt das amerikanische Raketenabwehrsystem in
Europa, im Mittleren Osten und im westlichen Pazifik dar. Damit schafft die USA
die Voraussetzungen für die Implementierung ihrer ›global
strike-conception‹, die
den Einsatz von konventionellen Gefechtsköpfen innert Stunden auf der gesamten
Welt vorsieht. Zum
Bedrohungs- und Gefahrenspektrum gehören für die Russische Föderation auch die
Lage in der Ukraine, der Terrorismus, Organisationen wie der Islamische Staat
und die Proliferation von Nuklearwaffen. Auch der Einsatz der Kommunikation
gegen Russland, die illegale Migration, der Menschenhandel, die Organisierte
Kriminalität und die Knappheit an Trinkwasser werden zum Spektrum der Bedrohung
gerechnet. [1] Ende Januar bot Putin
die Zusammenarbeit mit Europa an; das zweiteilige, in der ›Bildzeitung‹ vom 11. und 12. 1. veröffentlichte
Exklusivinterview mit Putin stellte eine energische Intervention zur
Kriegsvermeidung in Europa und gegen die Geopolitik dar. In diesem beschreibt
Putin die von deutscher Seite voll und ganz unterstützten Zusagen gegenüber der
Sowjetunion zur Zeit der Wiedervereinigung, die garantieren, dass die NATO
nicht nach Osten ausgeweitet wird. Indessen ist das Gegenteil eingetreten.
Hinzu komme, dass die USA trotz der Fortschritte bei der Einigung mit dem Iran
eine Raketenabwehr in Europa stationiert. Im zweiten Teil des Interviews räumt
Putin ein, dass der Ausschluss Russlands aus der G-8 zwar ein Verlust sei, dass
Russland jedoch weiterhin hochrangige Treffen mit der G-20, APEC und BRICS hat. Soweit
die Sicht Russlands.
Wenn
immer es darum geht, Putin selbst, seinen Regierungsstil und seine Ziele zu
verunglimpfen, so ist die Findigkeit Washingtons, des Westens und der Medien
schlichtweg nicht zu überbieten, was aus den folgenden, im Verhältnis zur Vielfalt
der ausgesprochenen Verleumdungen zahlenmässig geringen Beispielen hervorgeht:
Philip Breedlove, bis Mai 2016 Chef der United States European
Command (USEUCOM) mit Sitz in Stuttgart,
und NATO-Oberbefehlshaber, erklärte am 28. Januar: »Laut dem Bericht des
Europäischen Kommandos der US-Streitkräfte soll 2015 eines der schwierigsten
Jahre seit dem Ende des Kalten Krieges gewesen sein. In diesem wird Russland
als Aggressor in Osteuropa beschrieben; das Land sei daher neben dem
internationalen Terrorismus als grösste Gefahr für Europa zu sehen. Man werde
bei der neuen Strategie den Fokus verstärkt auf Russland, den Terrorismus und
die Migration legen. Mit neuen Militärmissionen wolle man ›den Frieden, die Freiheit und die Prosperität in Europa‹ sichern.« »Die Tatsache, dass die USA
und der Westen mit ihrer unverantwortlichen Politik für diese Gefahren selbst
verantwortlich sind«, vermerkt hierzu Christian Saarländer, »wird dabei natürlich
nicht erwähnt.« [2] Als Grund für die zur Gewährleistung der
Sicherheit ihrer europäischen Verbündeten im Finanzjahr 2017 geplanten 3,4
Milliarden $ nannte Obama Anfang Februar ›aggressive
Handlungen seitens Russlands an der Grenzen der Militärallianz‹. General Hans-Lothar
Domröse, ehemaliger General des Heeres der Bundeswehr und bis 4. März 2016
Oberbefehlshaber des Allied Joint Force Command in Brunssum, Holland, trug
bezüglich des Syrienkriegs Anfang Februar in einem Interview mit der
Tageszeitung ›Die Welt‹ eine, gelinde gesagt, recht abstruse Sicht vor: »Es macht uns
vielmehr grosse Sorge, dass Russland im Syrien-Konflikt bisher zweimal seine
Stärke demonstriert hat. Wir haben gesehen, dass ein russisches Kriegsschiff
Marschflugkörper aus dem Kaspischen Meer bis in den Irak hineingeschossen hat.
Zudem hat ein russisches U-Boot, das auf der Höhe Zyperns lag, dieselben
Geschosse in Richtung Syrien geschickt. Das war militärisch beides nicht
notwendig. Es war eine Machtdemonstration. ›Yes we can‹, war
Putins Botschaft. Wenn man vom Kaspischen Meer aus den Irak erreicht, dann
kommt man auch nach Berlin, London oder Paris.« ›Die
Welt‹: Wie soll die NATO darauf antworten? Domröse:
»Wir müssen
die Abschreckung erhöhen und gleichzeitig mit Russland reden. Auch wenn sich
Präsident Putin nicht an internationale Verträge hält.« [3] Wer
sich hier nicht an vertragliche Vereinbarungen hält, ist die NATO und der
Westen, das liegt längst vor aller Augen offen. Und mit der Bereitschaft des
Westens, mit Putin zu reden, ist es bekanntlich nicht weit her!
Auf der diesjährigen
Sicherheitskonferenz in München im Februar hat der russische Regierungschef
Dmitri Medwedew die Beziehungen zwischen Moskau und Westeuropa als ›neuen Kalten Krieg‹ bezeichnet: »Wir sind in eine neue
Periode des Kalten Kriegs hineingeraten. Die Beziehungen zwischen der Europäischen
Union und Russland sind verdorben, in der Ukraine tobt ein Bürgerkrieg. Praktisch jeden Tag werden wir zur grössten
Bedrohung erklärt, mal für die NATO insgesamt, mal für Europa, mal für die USA und
andere Länder. »Manchmal frage ich mich, ob wir im Jahr 2016 oder
im Jahr 1962 leben.«
Russland, beteuerte Medwedew ferner, werde jedoch weiterhin an der Umsetzung
der Friedensinitiative für das Bürgerkriegsland Syrien arbeiten. »Wir müssen
einen einheitlichen syrischen Staat erhalten«. Der Zerfall des Landes dürfe
nicht zugelassen werden. Die Welt könne sich ›kein
weiteres Libyen‹
leisten. [4]
Was
an geradezu irren Vorwürfen herumgeistert, zeigte sich in der Eröffnungsrede
zur Münchner Konferenz, die US-Senator McCain hielt: Bezüglich eines Friedensprozesses zeigte er
sich skeptisch: Schuld sei Russlands Präsident Putin. Der betrachte Syrien als
Übungsplatz für sein Militär und wolle so die Flüchtlingskrise in Europa
verstärken, um das transatlantische Projekt zu untergraben. McCain wörtlich: »Putins Hunger hat noch
zugenommen, je mehr er gegessen hat!« Des weiteren betonte
er, dass der russische Präsident ehrgeizige Ziele verfolge und eine Diplomatie
eingeschlagen habe, die im Dienste der Aggression stehe. Putin wolle die
Flüchtlingskrise verschärfen, um die EU zu unterminieren, auch der Iran
verfolge hegomonistische Ziele in der Region. Wenn Vereinbarungen Aggression
belohnen, wird das den Westen viel Glaubwürdigkeit kosten, mehr Terroristen
nach Syrien und mehr Angriffe auf den Westen bringen, warnte er; die Weltordnung
werde attackiert, die Machtbalance gerate aus den Fugen und er befürchte eine globale
Anarchie. Man müsse, so der Senator, entschlossen handeln und einen Kurswechsel vornehmen. Ein
solcher kann allerdings nur dann erfolgen, wenn Washington seine mit allen Mitteln
betriebene Einkreisung Russlands einstellt. Es war der Presse nicht zu
entnehmen, ob einer der Teilnehmer den Mut aufbrachte, McCain mit dieser
unabdingbaren Notwendigkeit zu konfrontieren. Die Rede von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg
war ein einziger Angriff auf Russland; auch er warf dem Land Aggressivität und
Destabilisierung der europäischen Sicherheitsordnung vor: Die NATO-Alliierten würden ›die illegale und illegitime Annexion der Krim nicht anerkennen.‹ Stoltenberg ferner: Das Militärbündnis werde die Ukraine weiter dabei
unterstützen, seine Souveränität und territoriale Unversehrtheit zu erhalten.
Russland habe massiv Truppen entlang der ukrainischen Grenze zusammengezogen,
sagte Stoltenberg nach einer Sitzung der NATO-Ukraine-Kommission. Die Separatisten
in der Ostukraine würden mit Ausrüstung, Waffen und Beratern unterstützt. Auf
der Halbinsel Krim setze Moskau gleichzeitig die militärische Aufrüstung fort. [5] Kein
Wort davon, dass auch der Umsturz in der Ukraine das Werk Washingtons ist, und
dass diese erneute US-Aggression in der Folge direkt zur Wiedereingliederung
der Krim in die Russische Föderation geführt hat.
Am 4.
Juni gelangte dann der Inhalt des neuen, von der Regierung abzusegnenden Weißbuchs
des BRD-Verteidigungsministeriums über ›Die
Welt‹ an die Öffentlichkeit. »Der
gefährlichste Aspekt«, schreiben die ›Deutschen
Wirtschafts Nachrichten‹ hierzu, »ist die
Umkehr der deutschen Haltung zu Rußland im Vergleich zum letzten Weißbuch von
2006. Russland sei kein ›Partner‹ mehr, sondern ein ›Rivale‹, wird ›Die Welt‹ zitiert. »Durch seine auf der Krim
und im Osten der Ukraine zutage getretene Bereitschaft, die eigenen Interessen
auch gewaltsam durchzusetzen und völkerrechtlich garantierte Grenzen einseitig
zu verschieben, stelle Russland die nach dem Kalten
Krieg geschaffene europäische Friedensordnung offen infrage.« Wo hätten
Washington und die NATO ihre als Demokratievermittlung getarnten Ziele nicht
mit Gewalt durchgesetzt? Und wer verschiebt hier Grenzen? Doch die
NATO. Nochmals: Was auf der Münchner Konferenz offen auszusprechen gewesen
wäre, ist der Fakt, dass die USA durch
die NATO die 1990 abgegebenen Versprechen, einen ›cordon sanitaire‹ zwischen den
NATO-Staaten und Russland zu belassen, überall im europäischen Raum klar
gebrochen hat. Heute stehen die Stützpunkte der NATO resp. der USA überall vor
den russischen Eingangspforten - von den baltischen Staaten bis zur Türkei. Jedenfalls
wird Russland des Einsatzes ›hybrider
Instrumente zur gezielten Verwischung der Grenze zwischen Krieg und Frieden‹ und einer ›subversiven Unterminierung anderer Staaten‹ beschuldigt. [6] Man
sollte meinen, dass bei der Drucklegung des Weißbuchs
die Länder verwechselt wurden,
denn die beiden letzten Punkte treffen nicht etwa auf Russland, sondern
unwiderlegbar auf die USA zu. So musste
auch der Vorsitzende des NATO-Militärausschusses, General Petr Pavel, am
21. Juni in einer Pressekonferenz zugeben, dass die Aufrüstung im Baltikum und
in Polen nicht durch eine reale russische Aggression zu begründen ist. Und General
Harald Kujat, früherer Vorsitzender des NATO-Militärausschusses, sagte in einem
Radiointerview Anfang Juli, in Krisenzeiten wie diesen wirkten militärische Massnahmen
immer als Eskalation. Besser wäre ein Dialog mit Russland zur Lösung der
zahlreichen Konflikte auf der Welt. Kujat spricht damit für einen Konsens unter
den deutschen Militär- und Strategieexperten, die überzeugt sind, dass der
Konflikt mit Russland vom Westen ausgeht und unnötig ist, und dass eine
Eskalation in einer nuklearen strategischen Machtprobe enden könnte. [7]
So erklärte denn auch Medwedew in München, dass die Zerstörung des
einheitlichen Wirtschaftsraumes und der europäischen Identität sowie der
Zerfall der Schengen-Zone aufgrund des unkontrollierten Andrangs von
Flüchtlingen eine echte Gefahr geworden sei: »Es ist die reale Gefahr
entstanden, dass der einheitliche Wirtschaftsraum, der nach Kriegsende
jahrzehntelang mit so grosser Mühe geschaffen wurde, zerstört wird. Und anschliessend
der kulturelle Raum und sogar die europäische Identität selbst.«
Gleichzeitig warnte er vor einer Konfrontation und sprach sich betont für eine
Konsolidierung von Russland und dem Westen aus.
Feindbild Russland
Nun hat
der Wiener Historiker und Publizist Hannes Hofbauer im März 2016 sein neues
Buch ›Feindbild Russland –
Geschichte einer Dämonisierung‹ im
Promedia Verlag veröffentlicht; das hierzu von ›Zeit-Fragen‹ mit
Hofbauer geführte Interview hält folgendes fest:
»Aktuelle
Situationen sind besser begreifbar, wenn
man die Geschichte der jeweiligen Entwicklungen darstellt«
Hofbauer:
Ich beschäftige mich schon länger mit Osteuropa, insbesondere auch mit der
Situation in der Ost-Ukraine seit der Gründung der unabhängigen Ukraine im Jahr
1991. Die für mich entscheidende Zäsur war im November 2013, als beim Gipfel
der Europäischen Union in Vilnius das Assoziierungsabkommen zwischen der EU und der Ukraine unterschrieben werden
sollte. Kiew hat dann relativ überraschend, wohl aus Gründen der
wirtschaftlichen Vernunft, nicht unterschrieben, und Brüssel hat diese Haltung
ignoriert. Ich habe mir damals gedacht: Da geht es jetzt nicht mehr nur um die
Ukraine, sondern mit der aggressiven westlichen Politik ist Russland gemeint.
Brüssel hat das «Njet» von Janukowitsch nicht akzeptiert. Das war für mich der
Punkt, an dem ich dachte: Jetzt ist der Zeitpunkt, um über die Ukraine
hinauszudenken, jetzt muss man über die Beziehungen zwischen dem Westen –
insbesondere der EU, und später den USA – zu Russland nachdenken.
Wie sind Sie darauf gekommen, dass
diese Reaktion gegen Russland gerichtet war? Weil die
Assoziierungsabkommen auf die Zollunion gezielt haben, die zwischen Russland,
Weissrussland, Kasachstan mit der Ukraine als assoziiertem Mitglied bestanden
hat. Dieses westliche Instrument der Erweiterung, der Heranführung der entsprechenden
Länder an die Wirtschafts- und Militärstrukturen der EU stand dem Projekt einer
Integration unter russischer Führung diametral entgegen. Es betraf ja nicht nur
die Ukraine, sondern auch fünf andere ehemalige sowjetische Republiken.
Janukowitsch selbst meinte, er wolle die Ukraine als Brücke zwischen Ost und
West verstehen und nicht nur in eine Richtung tendieren. Das hat Brüssel nicht
anerkannt.
Worum geht es in Ihrem Buch ›Feindbild Russland?
Ich sehe
mir insbesondere die letzten 20 Jahre an, um zu erklären, warum es im Jahr 2000
und danach wieder zu dieser Feindbild-Wahrnehmung gekommen ist, obwohl ja in
Westeuropa während der 90er Jahre eine völlig andere, positive Rezeption
Russlands bestand. Es fällt auf, dass Jelzins Politik für die Russländische
Föderation eine zerstörerische Funktion hatte, die dazu geführt hat, dass
Privatisierungen in wilder Manier durchgeführt worden sind. Russland wurde auch
territorial zersplittert, Republiken und autonome Regionen bekämpften sich. Der
Staat befand sich in Auflösung. Diesen Befund würde heute fast jeder in
Russland teilen, und mittlerweile sehen das auch sehr viele Leute im Westen so.
In der Phase zwischen 1991 und 1999 ist Russland gerade wegen dieser
katastrophalen Politik Jelzins in Westeuropa und den USA positiv dargestellt
worden. Mit der Machtübernahme Putins hat sich das geändert. Meiner Meinung
nach deswegen, weil Putin gleich am Anfang seiner Amtszeit klargestellt hat,
das Land konsolidieren zu wollen, sowohl administrativ als auch in bezug auf
die Ökonomie. Er brachte den Staat zurück auf die Bühne und versuchte, gegen
die ganz wilde Privatisierung vorzugehen. Das ist bisher allerdings nur
mangelhaft gelungen. Im Westen stiess die Putinsche Konsolidierung von Anfang
an auf Skepsis und später auf Widerstand, bis hin zu dem, was wir heute haben –
eine Feindbildgeschichte.
Was hat Sie dazu bewogen, die
ganze Geschichte des Feindbildes darzulegen? Sie beginnen ja Ihr Buch im 15.
Jahrhundert, beim Zarenreich, und gehen bis in die heutige Zeit.
Das hat mit meiner Ausbildung als Historiker zu tun. Ich bin der festen
Überzeugung, dass aktuelle Situationen besser begreifbar sind, wenn man die
Geschichte der jeweiligen Entwicklungen darstellt. Insofern ist es relativ
logisch, dass man an die Wurzeln des Feindbildes Russland geht, dorthin, wo es
seine Ursprünge hat. So bin ich im Zuge meiner Recherchen auf die Zeit des
späten 15. Jahrhunderts gekommen, in die Jahre zwischen 1470 und 1480, als Iwan
III. das Zarentum etablierte und die Tatarenoberherrschaft abschüttelte. Auf
dem Weg zur Ostsee ist der Zar auf den Deutschen Orden und die
polnisch-livländische Union gestossen. Und begleitend zu dieser durchaus
geopolitisch konfrontativen Situation war sofort von polnischen und deutschen
Philosophen eine Feindbildzuschreibung zur Hand. Der Krakauer Philosoph Johann
von Glogau hat dann das Wort vom halbasiatischen, barbarischen, schmutzigen
Russen geprägt, welches sich als Stereotyp über die Jahrhunderte gehalten hat.
Sie haben gesagt, dass das
Zurückdrängen der Privatisierung der Jelzin-Ära in Russland nur mangelhaft
gelungen ist. Heisst das, dass das noch nicht abgeschlossen ist oder dass die
Kreise, die eine Privatisierung vorantreiben, nach wie vor stark wirken?
Es gibt
eigentlich nur eine wesentliche Branche, die für Russland von grosser Bedeutung
ist, nämlich den Energiesektor, in der diese wilde Privatisierung eingedämmt
worden ist. Unter anderem durch die Verhaftung von Michail Chodorkowski im
Oktober 2003, als der Kreml klarmachte, dass kein amerikanisches Kapital in
diese Branche eindringen soll. Es war nämlich die Absicht von Chodorkowski,
seinen Yukos-Konzern an Exxon Mobil zu verkaufen. Dem ist mit seiner Verhaftung
ein Riegel vorgeschoben worden, und die ganze Branche ist heute wieder mehr
unter staatlicher Kontrolle. Ansonsten ist Russland nach wie vor in weiten
Teilen eine Oligarchen-Ökonomie, und man kann überhaupt nicht davon reden, dass
die Privatisierung zurückgedrängt wird. In einzelnen Bereichen gibt es
staatliche Anstrengungen, zum Beispiel bei der Infrastruktur, aber die
Oligarchen haben im grossen und ganzen weiter freies Feld.
Der Verhaftung Chodorkowskis
folgte im Westen ja eine deutlich wahrnehmbare Änderung der Stimmung gegenüber
Russland.
Ja, absolut, das war für Amerika nicht hinnehmbar. Es ist ja um den
amerikanischen Konzern Exxon Mobil gegangen. Der damalige US-Vizepräsident Dick
Cheney war selbst in die Verhandlungen involviert, und Putin persönlich ist
nach Washington geflogen, um zu signalisieren, dass ohne Einverständnis auf hoher
politischer Ebene ein solcher Deal nicht über die Bühne gehen könne. Nach der
Verhaftung von Chodorkowski haben die Amerikaner extrem aggressiv reagiert und
gemeint, es sei kein Verlass mehr auf Russland, das private Kapital sei nicht
geschützt. Obwohl natürlich gesagt werden muss, dass in strategisch wichtigen
Branchen in jedem Land ausländischem Kapital argwöhnisch und feindselig
begegnet wird. [1]
In einem Kapitel Ihres Buches geht
es um die Sanktionspolitik gegen Russland.
Die Sanktionen begannen im März 2014 – parallel zum Zusammenbruch der Ukraine
und der Vertreibung von Janukowitsch aus dem Präsidentenamt, der
verfassungswidrigen Machtübernahme in Kiew und der Eingliederung der Krim in
die Russländische Föderation. Die Europäische Union und die USA sind im
Gleichschritt marschiert. Am 6. März 2014 wurden Sanktionen gegen führende
Persönlichkeiten erlassen, die den, wie es hiess, demokratischen Prozess in der
Ukraine unterminieren, eine sehr beliebige Ausdrucksweise für das, was dort am
Anfang des Bürgerkrieges stand. Kurz darauf, im April, wurden die Sanktionen
ausgeweitet. Nun waren nicht mehr nur Personen betroffen, die mit
Einreiseverboten, Kontosperren und so weiter belegt wurden, sondern auch
Unternehmen und ganze Branchen. Insbesondere drei Branchen sind mit westlichen
Sanktionen konfrontiert: Militärgüter, Produkte, die mit der Erdöl- und
Erdgasförderung zu tun haben, nicht jedoch die Erdgaslieferung selbst, und der
Bankensektor. Im August desselben Jahres 2014 reagierte Russland mit Gegensanktionen
im Agrarsektor. Das betrifft fast ausschliesslich die Länder EU-Europas, weil
die Amerikaner mit Russland kaum entsprechende Wirtschaftskontakte haben.
Nochmals grundsätzlich zu Ihrem
Buch, zum Thema Feindbilder. Im Buch stellen Sie die Ereignisse ja immer im
geostrategischen Zusammenhang der Beziehungen zwischen EU und Russland dar.
Sind Feindbilder immer mit einer politischen Zielrichtung, als politisches
Instrument geopolitischer, strategischer Ziele zu sehen?
Feindbildern
gehen Feindschaften voraus, begleiten sie im historischen Kontext und bereiten
die Heimatfront auf eine mögliche grössere Auseinandersetzung vor, wenn man das
etwas überspitzt formulieren will. Das ist ja das Gefährliche daran,
insbesondere auch, weil die Trennlinie quer durch Europa geht. Diejenige Kraft,
die das besonders betreibt, zumindest seit der Kiewer Maidan im Februar/März
2014 gewalttätig geworden ist, sind die USA. Das muss klargemacht werden: Wie
ökonomisch expansiv diese Assoziierungsabkommen der EU auch waren, so ist es
die US-amerikanische Politik, die derzeit ein geopolitisch höchst gefährliches
Spiel spielt, gefährlich auch deshalb, weil Washington bei den Sanktionen kaum
etwas zu verlieren hat. Der wirtschaftliche Austausch zwischen Russland und der
EU lag vor dem Embargo im Bereich von 30–40 % aller Ex- beziehungsweise
Importe, während er mit den USA im Bereich von 2–3 % liegt. Das heisst, alles,
was sich auf dieser Wirtschaftskriegsebene abspielt, betrifft die Amerikaner
kaum, insofern können sie auch viel aggressiver sein. Ich ziehe daraus auch den
Schluss, dass es von amerikanischer Seite her nicht nur gegen Russland, sondern
auch gegen die EU geht.
Wie kann man diesem Feindbild
entgegenwirken?
Mit Information
und Aufklärung, und die ist nicht vergebens, weil die Medien, die das Feindbild
in die Haushalte tragen, in den vergangenen Jahren einen extremen
Glaubwürdigkeitsverlust hinnehmen mussten. Ich spreche hier von den
meinungsbildenden Medien. Die Menschen informieren sich immer mehr über andere
Wege, über alternative Medien. Man sieht ja, dass zum Beispiel die
Sanktionspolitik keinen massenhaften Zuspruch in Deutschland, Österreich und
der Schweiz hat. In der Schweiz sowieso nicht, denn sie macht ja bei den
Sanktionen nicht mit, und das ist schon mal ein gutes Zeichen. Im Volk ist
das Feindbild Russland weniger verankert
als bei den Eliten. Aber auch die Eliten sind gespalten. Zum Beispiel gibt es
in Deutschland Unternehmerkreise, die genau sehen, wie sie sich mit den Sanktionen
ins eigene Fleisch schneiden, und sie deshalb ablehnen.
Wie wird dieses Russlandbild von
den Menschen in Russland wahrgenommen? Ist es dort bekannt, wissen diese, wie
in den westlichen Medien über Russland geschrieben wird?
Absolut,
das wird sehr wohl reflektiert. Am Anfang, also unmittelbar nach dem Beitritt
der Krim zur Russländischen Föderation, ist man dem Vorgang mit etwas
Unverständnis begegnet, weil man sich nicht vorstellen konnte, dass sich dieser
zu einer solchen Krise ausweiten könnte. Wir dürfen nicht vergessen, dass das Russland-Bashing
schon lange davor eingesetzt hatte, nämlich schon 1999 beim NATO-Krieg gegen
Jugoslawien. Schon damals verschlechterte sich die Beziehung zwischen dem
Westen und Russland. Die Mehrheit der Menschen in Russland hat damals aber auch
miterlebt, wie der Kosovo aus Jugoslawien herausgelöst wurde, und war dagegen.
Viele Staaten haben den Kosovo als eigenständiges Land anerkannt, andere jedoch
nicht; sogar in der EU gibt es fünf Länder, die die Staatlichkeit Kosovos nicht
anerkennen. Heute ist es umgekehrt. Russland hat sich einen Teil der Ukraine,
die Krim – die Geschichte der Krim wäre noch extra zu behandeln – ins eigene
Staatsgebiet einverleibt, und plötzlich steht man vor einer grossen
militärischen Auseinandersetzung. Das war für die Menschen in Russland kaum zu
verstehen, warum deswegen international so grosse Aufregung besteht. Die Think
Tanks in Moskau sind interessanterweise sehr gut auf dieses Szenario
vorbereitet und diskutieren die Folgen der Sanktionen offen. Es gibt einige,
die eher der Meinung sind, Russland müsste sich einem eurasischen Projekt
annähern, und die Vorstellung von einem Wirtschaftsraum, der von Lissabon bis
nach Wladiwostok geht, in einen Integrationsraum ändern, der von Brest Litowsk
bis nach Schanghai reicht. Dann gibt es wieder andere Institute, die sagen,
ohne die EU könne Russland ökonomisch nicht überleben. Diese haben allerdings
die nicht unberechtigte Angst, die EU könne eventuell ihre
Integrationsversprechen nicht einhalten, unabhängig von den Sanktionen, weil die
EU selbst am Scheideweg steht und es nicht klar ist, ob es sie überhaupt noch
länger in dieser Art geben wird. [8]
[1] http://strategische-studien.com/2016/01/20/russlands-neue-umfassende-sicherheitskonzeption/
20. 1. 16
[2] https://www.contra-magazin.com/2016/01/neue-europa-strategie-usa-epressen-europa-mit-der-russischen-gefahr/ 28. 1. 16
Christian
Saarländer
[3]
http://www.welt.de/politik/ausland/article151805608/Nato-General-besorgt-ueber-russische-Machtdemonstration.html 4. 2. 16
Interview mit NATO-General Hans-Lothar Domröse
[4] http://bazonline.ch/ausland/europa/Wir-sind-in-einem-neuen-Kalten-Krieg/story/10519474
13. 2. 16
[5] http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/06/15/nato-fordert-von-russland-abzug-von-truppen-aus-der-ukraine/
15. 6. 16
Nato fordert
von Russland Abzug von Truppen aus der Ukraine
[6] http://deutschewirtschafts-nachrichten.de/2016/06/06/merkelerklaert-russland-zum-rivalen-von-deutschland/ 6. 6. 16
[7] Strategic Alert Jahrgang 29, Nr.27
vom 6. Juli 2016
[8] http://www.zeit-fragen.ch/de/ausgaben/2016/nr-15-5-juli-2016/feindbild-russland.html Zeit-Fragen Nr. 15 vom 5. Juli 2016
Das Interview führten Eva-Maria Föllmer-Müller und Erika Vögeli
|
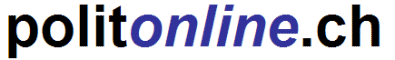

 Feindbild Russland 10.07.2016 23:49
Feindbild Russland 10.07.2016 23:49