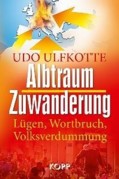Notiz zum Brexit 18.11.2018 22:26
Notiz zum Brexit 18.11.2018 22:26
Nach der Lektüre des Berichts von »German Foreign Policy« zum Brexit
bleibt man eher
konsterniert zurück, zumal auch hier die Arroganz von EU-Kommissionsmitgliedern
klar zutage tritt.
An die
EU gefesselt
»Von
der EU erzwungene Festlegungen im Entwurf des Brexit-Abkommens führen zu
massiven Verwerfungen in Großbritannien und rufen Forderungen nach einem ›harten‹ Brexit hervor. Die
Festlegungen laufen darauf hinaus, dass London für 21 Monate, vielleicht sogar
noch länger, neue EU-Vorschriften in nationale Regelwerke übernehmen muß, ohne
über sie mitbestimmen zu können. Darüber hinaus zwingen sie das Vereinigte
Königreich in eine Zollunion mit der EU, die eine eigenständige ökonomische
Entwicklung des Landes unmöglich macht. Dieser kann London aber nur mit Zustimmung
Brüssels entkommen.
Mehrere britische
Minister und Staatssekretäre sind am 15. November zurückgetreten; der aus dem
Amt geschiedene Brexit-Minister Dominic Raab wirft der EU ›Erpressung‹ vor. Die stellvertretende
Verhandlungsführerin der Union, die Deutsche Sabine Weyand, die eine
hervorgehobene Rolle in den Verhandlungen gespielt hat, prahlt, Großbritannien
müsse ›seine
Regeln anpassen‹; die
EU hingegen behalte ›die
gesamte Kontrolle‹. Ein ›harter‹ Brexit kostete deutsche
Unternehmen Milliardensummen.
Übergang
ohne Ende
Der Entwurf für das
Brexit-Abkommen enthält auf Druck der EU an gleich mehreren Stellen
Festlegungen, die für einen souveränen Staat kaum akzeptabel sind. Eine davon
bezieht sich auf die Übergangsperiode nach dem britischen Austritt aus der EU
am 29. März 2019, während der unter anderem ein umfassendes Freihandelsabkommen
zwischen beiden Seiten erarbeitet werden soll. Wie es in dem Entwurf heißt,
sollen die Entscheidungen, die die EU-Institutionen vor dem Ende der
Übergangsperiode treffen, für das Vereinigte Königreich verbindlich sein.
Gleichzeitig hat London keine Möglichkeit mehr, an der Entscheidungsfindung
mitzuwirken, muß
also zu 100 % fremdbestimmte Vorschriften in nationale Regelwerke übernehmen.
Hinzu kommt, dass die Übergangsperiode beliebig verlängert werden kann; im
Vertragsentwurf ist von einem Endpunkt am ›31.
Dezember 20XX‹ die
Rede, wenn das Freihandelsabkommen zum ursprünglich vorgesehenen Ende der Übergangsperiode am 31. Dezember 2020 nicht
fertig ausgehandelt ist. Verschleppt
Brüssel die Verhandlungen oder beharrt es auf Positionen, die für London nicht
akzeptabel sind, dann können endlose Verlängerungen notwendig werden; der
britische Austritt wäre Makulatur.
Zollunion
ohne Ausweg
Bricht London, um
dieser Falle zu entkommen, die Verhandlungen ab, dann tritt der sogenannte Backstop
in Kraft. Offiziell geschieht dies nur, um zu verhindern, dass an der Grenze
zwischen der Republik Irland und Nordirland, die zur EU-Außengrenze wird,
Personen- und Warenkontrollen in großem Stil durchgeführt werden. Der Backstop
sieht vor, dass eine Zollunion [single
customs territory] zwischen der EU und
dem Vereinigten Königreich geschaffen wird, wobei Nordirland über den
Binnenmarkt noch enger an die EU gebunden werden soll als England, Wales und
Schottland.
Das führt zum einen zu
einer Ungleichbehandlung zwischen Nordirland sowie den anderen Teilen des
Vereinigten Königreichs und verletzt damit die britische Integrität ebenso, wie
eine Zollgrenze zwischen deutschen Bundesländern gegen die Integrität der
Bundesrepublik verstieße. Zum anderen ist ein Ausstieg aus dem Backstop nur
möglich, ›sofern
die Union und das Vereinigte Königreich gemeinsam beschließen ….., dass die
Regelung nicht mehr angewendet werden soll‹.
Die EU hat also die Möglichkeit, durch einfaches Nicht-Zustimmen den Backstop zu verlängern - auf Dauer. Auch in diesem Fall
steckte das Vereinigte Königreich also in der Falle.
›Die
gesamte Kontrolle‹
Dies wiegt umso schwerer,
als die Zollunion, in der die EU Großbritannien gefangen
hielte, es London nach allgemeiner Interpretation der Terminologie des
Vertragsentwurfs unmöglich macht, eigene Freihandelsabkommen zu schließen.
Letztere aber sind ein zentrales Element der Brexit-Strategie maßgeblicher
Befürworter des britischen EU-Austritts, die darauf abzielen, dass sich die
britische Nationalökonomie nicht so sehr an der nur noch wenig wachsenden
Wirtschaft Europas orientiert als vielmehr an der stärker wachsendem
Nordamerikas und vor allem an den attraktiven Boomregionen Ost- und
Südostasiens. Großbritannien wäre ökonomisch an die EU gefesselt und der
erhofften eigenständigen Entwicklung beraubt. Im Wesentlichen hat dies bereits
am Dienstagabend, 13. 11., die Vertreterin des EU-Verhandlungsführers Michel Barnier, Sabine Weyand, gegenüber den EU-Botschaftern der
EU-27 bestätigt: »Das Königreich muß seine Regeln
anpassen«, wird
Weyand zitiert, »aber die EU
behält die gesamte Kontrolle«. Laut EU-Ratspräsident Donald Tusk hat die Deutsche Sabine Weyand
im Rahmen der Verhandlungen eine herausgehobene Rolle gespielt.
›Erpressung‹
Die Aussichten, die der
Entwurf des Brexit-Abkommens eröffnet, haben am 14. 11. in London zu massiven
Verwerfungen geführt, von denen noch nicht klar ist, ob Premierministerin
Theresa May sie übersteht. Mehrere Minister sowie mehrere Staatssekretäre sind
zurückgetreten, darunter Brexit-Minister Dominic Raab. May-Gegner planen ein Mißtrauensvotum
gegen die Regierungschefin im Parlament. Als äußerst ungewiß, zunehmend
sogar als unwahrscheinlich gilt, dass der Entwurf für das Brexit-Abkommen die
nötige Zustimmung im House of Commons erhält. Während Brexit-Gegner erneut eine
Wiederholung des Referendums verlangen, für die im Parlament bislang keine
Mehrheit in Sicht ist, mehren sich die Stimmen, dem jetzt vorgelegten
Vertragsentwurf einen ›harten‹ Brexit vorzuziehen. Wie Raab
urteilt, werde er für das Vereinigte Königreich zwar kurzfristig zu
schwerwiegenden ökonomischen Einbußen führen; doch sei das weniger schädlich,
als von der EU jahrelang wirtschaftlich gefesselt zu sein. Der bisherige
Brexit-Minister nennt die Verhandlungstaktik der EU ›Erpressung‹.
Keine
Nachverhandlungen
Verschärft wird die
Lage dadurch, dass Berlin und Brüssel Nachverhandlungen bislang verweigern und
die Spaltung der britischen Gesellschaft zwischen Gegnern und Befürwortern des
Brexit mit demonstrativen Angeboten vertiefen, doch lieber EU-Mitglied zu
bleiben. Sie sei sehr froh über den Vertragsentwurf, teilte Bundeskanzlerin
Angela Merkel mit: »Die
Frage, ob wir etwas weiterverhandeln, stelle sich überhaupt nicht«. EU-Verhandlungsführer Barnier nennt den Entwurf
eine ›gerechte
und ausbalancierte Lösung‹, eine
Äußerung, die nicht nur von entschlossenen Brexit-Befürwortern in Großbritannien
als blanker Zynismus empfunden wird. Ähnliches gilt für die gestrige Behauptung
von EU-Ratspräsident Donald Tusk, er werde alles tun, um unseren britischen
Freunden ... den Abschied so wenig schmerzhaft wie möglich zu machen. Tusk, der
vor kurzem mit einem Spott-Tweet auf Premierministerin May heftigen Unmut im
Vereinigten Königreich ausgelöst hat, legt London jetzt zum wiederholten Mal
den Verbleib in der Union nahe. Auf diesen Fall sei Brüssel ›am besten vorbereitet‹, erklärte Tusk gestern.
Milliarden
auf dem Spiel
Während sich die
Auseinandersetzungen in London zuspitzen, warnt Bundesfinanzminister Olaf
Scholz vor einer ›ungeordneten
Entwicklung‹ in
Sachen Brexit: Sie wäre ›das
Schlimmste, was passieren kann‹.
Tatsächlich hat die deutsche Wirtschaft im Fall eines ›harten Brexit‹ Einbußen in Höhe von möglicherweise mittleren zweistelligen Milliardensummen zu
befürchten. Wirtschaftsverbände schließen sich dementsprechend den
Warnungen des Bundesfinanzministers an. »Für
ein Aufatmen sei es leider noch zu früh«,
wird Eric Schweitzer, der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), zitiert: »Entscheidend sei, ob die britische Regierung das
Parlament überzeugen kann«.
Die Chancen dafür sind mit der Tatsache, dass die Union kaum akzeptable
Festlegungen im Entwurf für das Brexit-Abkommen durchgesetzt hat, erkennbar
gesunken. [1]
Bereits
im März dieses Jahres hatte es geheißen, dass die Weigerung Brüssels, in ein
Post-Brexit-Handelsabkommen mit Großbritannien nicht nur den Schutz von EU-Interessen,
sondern auch eine Öffnung für die britische Finanzbranche einzubeziehen, einen ›harten Brexit‹ wahrscheinlicher
werden lasse. Zudem wendete sich die Stimmung in Großbritannien angesichts der
EU-Obstruktionspolitik immer mehr gegen Brüssel. Sogar britische Brexit-Gegner haben
die Arroganz der EU beklagt und gewarnt, ein Großbritannien, das sich »von der EU
gedemütigt fühlt, könnte ein unbequemer Nachbar sein«.
Anfang
März hatte auch einer der prominentesten
Kommentatoren der ›Financial Times‹, Gideon Rachman, vor ›gefährlichen
Folgen‹ der Brüsseler Obstruktionspolitik
gewarnt. Großbritannien, schrieb Rachman, ›sei nicht irgendein Drittstaat: Es habe
seit Jahrhunderten eine entscheidende Bedeutung für Europas Kräftegleichgewicht
gehabt und es sei bis heute ein wichtiger Handelspartner und militärischer
Bündnispartner für die meisten EU-Länder‹.
…….. Schließlich aber könne die EU darauf setzen, ›eine
Krise zu erzwingen‹, in der Hoffnung, dass die britische Regierung stürze und die Nachfolgeregierung
das Austrittsreferendum außer Kraft setze. [2]
[1] https://www.german-foreign-policy.com/news/detail/7785/
16. 11. 18 An die EU gefesselt
[2] https://www.german-foreign-policy.com/news/detail/7560/ 13. 3. 18
Die Arroganz der EU
|
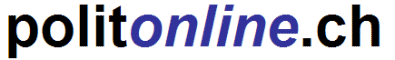

 Notiz zum Brexit 18.11.2018 22:26
Notiz zum Brexit 18.11.2018 22:26